In den Wissenschaften, wie in vielen anderen Berufen auch, geht es vor allem oft um eins: netzwerken. Wen fragt man für eine Forschungskooperation, wen stellt man ein für einen Job, der vielleicht mehr inoffiziell als offiziell ausgeschrieben ist? Welche*r junge Wissenschaftler*in scheint aktuell besonders vielversprechend und sollte vielleicht einmal eingeladen werden? All das sind Fragen, welche sich in den Wissenschaften gestellt werden.
Someone like you? Someone like me.
Wenn man sich überlegt, wen man einstellt, dann doch am besten jemanden, der oder die so ähnlich denkt wie man selbst. Der Prozess, welcher entscheidet, wer in den Wissenschaften erfolgreich ist und wer nicht, wird als „Gatekeeping“ bezeichnet.

Dabei stellt man sich den Zugang zu den (Natur-) Wissenschaften wie ein Tor vor, welches für manche weit offen steht und für andere verschlossen ist. Die Personen, welche Einfluss darauf haben, wie weit das Tor für jemanden geöffnet ist, heißen „Gatekeepers“ (deutsch: Torwächter). Nun entsteht folgendes Problem: Wenn die Naturwissenschaften ein männlich-dominiertes Berufsfeld sind und man(n) am liebsten Leute einstellt, die so sind wie man selbst, dann bleiben die Naturwissenschaftler (männlich) unter sich. Das Phänomen ist bekannt als „similar to me effect“ – so ähnlich wie ich.
Ich suche da jemanden…
Van den Brink und Benschop erklären, dass in den Naturwissenschaften oft inoffiziell nach dem/ der nächste*n Mitarbeiter*in gesucht wird. Somit ist die Besetzung der Stelle oft bereits entschieden, bevor Bewerber*innen von ihrer Ausschreibung erfahren:
„Auf diese Weise entscheiden Gatekeeper über die Zusammenstellung der Kandidat*innen. Gatekeeping betrifft mehrere Phasen des Einstellungsprozesses, da es Einfluss darauf hat welche Kandidat*innen aufgelistet, interviewt und nominiert werden.“ (Übersetzung d.A.)
Dieser Prozess ist für Außenstehende unsichtbar. So unsichtbar sogar, dass manchmal die Rede von sogenannten „invisible colleges“ ist – den unsichtbaren Universitäten. Diese Verbünde haben laut Bucchi oft mehr Einfluss darüber, was an der Universität geschieht und geforscht wird, als Fachbereiche, Institute, oder Komittees.
Knock knock. Who’s there?
Auch die Türen sind nicht immer sofort erkennbar, wie Nobelpreisträgerin Getrude Elion einmal feststellte, als sie sagte:
„Ich wusste gar nicht, dass manche Türen für mich verschlossen sind, bis ich anfing, daran zu klopfen“ (Übersetzung d.A.).
Ein*e anonyme*r Kandidat*in in einer Studie von Anderson et al. sagte einmal sehr treffend, man könne den Sinn des Lebens entdecken und niemand würde einen beachten, wenn man nicht zuvor das Ansehen der wissenschaftlichen Gemeinde gewonnen hat. Man müsse „die Nase durch die Tür“ stecken und als Kolleg*in anerkannt werden, Mitglied im „Old Boys’ Club“ sein, damit man erhört wird. Auch hilft es, bei Bewerbungen ein paar wichtige Namen fallen zu lassen – und zwar die derjenigen, welche bereits im Old Boys’ Club sind. Natürlich ist das problematisch, aber verändert wird es bisher trotzdem nicht. Warum nicht?
„Never change a winning team“
Die beliebteste Erklärung scheint zu sein, dass in den (Natur-) Wissenschaften doch alles bestens funktioniert. Daher werden Kandidat*innen bevorzugt, welche in das bestehende „Erfolgsmodell“ passen. Interessant ist dabei, dass auch weibliche Gatekeeper hier Männer einstellen, wie die zuvor erwähnte Studie von van den Brink und Benschop zeigt. Während Männer passgenauer die Ideale der Wissenschaft erfüllen, werden Frauen stattdessen als Risiko gesehen, da ihre “Kompetenz, Kongruenz, ihr Engagement und ihre Glaubwürdigkeit“ nicht automatisch auf das Erfolgsmodell übertragen werden (van den Brink and Benschop, Übersetzung d.A.).

Die Annahme, dass Naturwissenschaftlerinnen entweder weniger fachlich kompetent sind, oder das Fach eher verlassen werden, um eine Familie zu gründen, führt zu geringerem Erfolg – und damit zur Bestätigung der vorhergehenden Annahmen. Auch wenn es stimmt, das Frauen ihre Karriere weit häufiger als Männer beenden oder reduzieren, um Elternteil zu sein. Aber was wäre denn, wenn sich Frauen einfach gegenseitig unterstützten?
Und wenn Frauen das auch machen?
Weibliche Vorbilder nehmen großen Einfluss auf den Erfolg von Mädchen und Frauen, gerade in den Naturwissenschaften. Sie können dazu inspirieren, eine Karriere in den Naturwissenschaften anzufangen, oder auch beizubehalten. Da es gerade in Bereichen wie Physik oder Informatik wenige Frauen gibt, würde es doch Sinn machen wenn diese ein ähnliches Netzwerk, einen Old Girls’ Club formen würden, oder? Nur leider ist das in den Wissenschaften gar nicht gern gesehen.
Eine Studie beweist, dass während nur Frauen den „Old Boys’ Club“ für problematisch halten, Männer und Frauen ähnliche Netzwerke unter Frauen als negativ einstufen (vergleiche van den Brink and Benschop). Auf einmal gibt es zu viel Vitamin B im System, werden Chancen nicht mehr gerecht verteilt. Das liegt daran, dass dieser Prozess höchst sichtbar ist, während der Old Boys’ Club es nicht ist.
Als Frau in den Naturwissenschaften kann man es nicht riskieren, als voreingenommen oder gar feministisch zu gelten. Es ist ein Balance-Akt, weiblich genug und dennoch nicht zu weiblich für die Naturwissenschaften zu wirken (vgl Carr und Kelan). Immer noch versuchen Frauen daher, ein Teil des Old Boys’ Club zu werden – was wieder einmal beweist, wie viel sich in den Wissenschaften noch verändern muss.
Cora Övermann


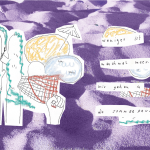
Schreibe einen Kommentar